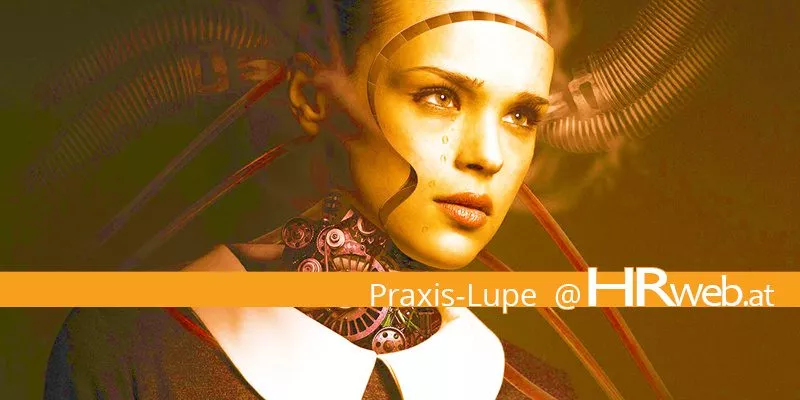In der heutigen Arbeitswelt nimmt die Zahl der Selbständigen stetig zu. Doch nicht immer handelt es sich bei diesen Personen tatsächlich um echte Selbständige. Ein Phänomen, das immer wieder auftaucht, ist die sogenannte Scheinselbständigkeit (konkret bezogen auf Österreich).
Gemeint ist damit die Umgehung arbeitsrechtlicher, sozialversicherungsrechtlicher und steuerlicher Regelungen in Österreich.
Was ist Scheinselbständigkeit?
Scheinselbständigkeit liegt vor, wenn eine Person zwar als Selbständige oder Selbständiger auftritt, tatsächlich jedoch eine Tätigkeit ausführt, die der eines angestellten Arbeitnehmenden entspricht. Der vermeintliche Selbständige erbringt zwar gemäß Vertrag selbständige Leistungen für ein anderes Unternehmen, ist dabei jedoch sowohl persönlich als auch wirtschaftlich abhängig. Das kann entweder einvernehmlich geschehen, aber auch „unabsichtlich“ aufgrund von Unwissenheit oder auch „absichtlich“ zur Umgehung von zwingenden Vorschriften.
Welche Kriterien deuten auf Schein-Selbständigkeit (Österreich) hin?
Der echte Arbeitsvertrag ist durch die persönliche Abhängigkeit des Arbeitnehmenden vom Arbeitgebenden gekennzeichnet. Selbständige Auftragnehmende hingegen bestimmen weitgehend selbst über die Umstände ihrer Leistungserbringung und tragen das wirtschaftliche Risiko. Zudem sind selbständige Auftragnehmende weder an persönliche Weisungen gebunden noch in den organisatorischen Ablauf des Auftraggebenden eingebunden. Demnach verrichten selbständige Auftragnehmende das „Werk“ mit eigenen Betriebsmitteln und eigener Organisation, können aber Gehilfen und Subauftragnehmende beiziehen.
Folgende Merkmale sprechen gegen eine echte Selbständigkeit und damit für eine Scheinselbständigkeit:
- Das Vertragsverhältnis ist nicht auf einen definierten Erfolg und/oder Arbeitsergebnis ausgerichtet.
- Der Auftragnehmende hat keine eigene unternehmerische Struktur (zB Gewerbeberechtigung, eigene Mitarbeitende, etc).
- Die Auftragnehmende ist hinsichtlich Ort und Zeit seiner Leistungserbringung an die Vorgaben des Auftraggebenden gebunden.
- Der Auftragnehmende verwendet Arbeits- und Betriebsmittel der Auftraggebenden.
- Die Arbeit erfolgt weisungsgebunden und eingebunden in die Organisation des Auftraggebenden.
- Die Auftragnehmende hat keine anderen Auftraggebenden.
- Der Auftragnehmende erbringt die Arbeitsleistung persönlich, ohne dass er Mitarbeitende einsetzen oder sich vertreten lassen darf.
- Die Auftragnehmende hat eine eigene Durchwahl / scheint im Organigramm auf / hat Visitenkarten des Auftraggebenden etc.
- Der Auftragnehmende nimmt an Veranstaltungen des Auftraggebenden teil.
Bei der rechtlichen Einschätzung, ob „echte“ Selbständigkeit oder Scheinselbständigkeit vorliegt, handelt es sich um ein bewegliches System. Das heißt einerseits, dass zwar jedes Kriterium grundsätzlich vorliegen und für sich genommen bejaht werden muss, die Intensität untereinander unterschiedlich sein kann. Schwach ausgeprägte Kriterien können durch stark ausgeprägte Kriterien aufgewogen werden. Andererseits heißt es, dass selbst bei Vorliegen aller Kriterien ein Gericht oder eine Behörde zu einem anderen Ergebnis als die hier vorgenommene Einschätzung kommen kann. Es ist daher stets eine Gesamtbetrachtung aller Kriterien und des konkreten Einzelfalls notwendig.
Welche Konsequenzen drohen?
Für die Auftraggebenden hat bei Scheinselbständigkeit in Österreich die Umqualifizierung eines Auftragnehmenden in einen echten Arbeitnehmenden weitreichende Folgen. Die „Umqualifizierung“ kann zu erheblichen Kosten im sozialversicherungs-, arbeits- und abgabenrechtlichen Bereich führen.
1. Arbeitsrecht
Die Umqualifizierung einer Auftragnehmenden in einen echten Arbeitnehmenden hat zur Folge, dass das Arbeitsrecht anwendbar ist und dem scheinbar Selbständigen durch die Umqualifizierung des Vertragsverhältnisses alle arbeitsrechtlichen Ansprüche (wie insbesondere Kündigungsschutz, Urlaubsanspruch, Lohnfortzahlung bei Krankheit) zustehen. Damit drohen den Arbeitgebenden – zusätzlich zum bereits bezahlten Honorar – nachträgliche finanzielle Leistungen (insbesondere Urlaubsersatzleistung, Überstunden- und Feiertagsentgelt und weiterer Ansprüche, die auf dem Kollektivvertrag beruhen). Für arbeitsrechtliche Ansprüche gilt mangels anderer Regelungen im Kollektivvertrag oder Arbeitsvertrag die allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren ab Fälligkeit.
2. Sozialversicherungsrecht
Wird das Vertragsverhältnis zwischen dem (Schein-)Selbständigen und seinem Auftraggebenden im Nachhinein zu einem Arbeitsverhältnis umqualifiziert, stellt sich auch die Frage nach den sozialversicherungsrechtlichen Folgen. Der nunmehrige Arbeitgebende muss die gesamten Sozialversicherungsabgaben rückwirkend für bis zu 5 Jahre nachzahlen. Als Berechnungsgrundlage werden die bisherigen „Nettogehälter“ verwendet. Die Arbeitgebende muss sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmeranteile übernehmen.
3. Steuerrecht
Bestehen Einkommenssteuerschulden, so haftet der Auftraggebende bis zur Höhe der Lohnsteuern, die er an das Finanzamt abführen hätte müssen, wenn der Scheinselbständige als Arbeitnehmender abgerechnet worden wäre. Wird auch umsatzsteuerlich die Unternehmereigenschaft des Auftragnehmenden verneint, war er nicht zum Ausweis der Umsatzsteuer berechtigt. Folglich war und ist der Vorsteuerabzug für den Auftraggebenden unzulässig. Die abgezogene Vorsteuer muss für alle noch nicht veranlagten Jahre zurückgezahlt werden.
Fazit und Empfehlungen
Die Grenze zwischen Scheinselbständigkeit und echter Selbständigkeit ist oft schwer zu ziehen. Das führt zu erheblichen rechtlichen Problemen und Risiken sowohl für Auftraggebende und Auftragnehmende als auch für Arbeitgebende und Arbeitnehmende. Probleme mit der Scheinselbständigkeit ergeben sich oft erst später, zB wenn es zu einer Trennung kommt oder sich die Umstände für eine oder beide Parteien ändern. Wenn Anhaltspunkte für ein Scheinverhältnis vorliegen, kann das zu einer Umqualifizierung führen, mit erheblichen Kosten und Nachteilen im sozialversicherungs-, arbeits- und abgabenrechtlichen Bereich.
Um rechtlichen Problemen im Zusammenhang mit Scheinselbständigkeit in Österreich vorzubeugen, achten Sie darauf, dass die Merkmale einer echten Selbständigkeit gewahrt bleiben, zum Beispiel:
Vermeidung arbeitsrechtlicher Analogien
Achten Sie darauf, dass keine Merkmale eines Angestelltenverhältnisses bestehen, wie beispielsweise eine Anwesenheitspflicht an einem festen Arbeitsplatz oder feste Arbeitszeiten.
Arbeits-Recht: Scheinselbständigkeit Österreich | Was ist das und weshalb ist es riskant?